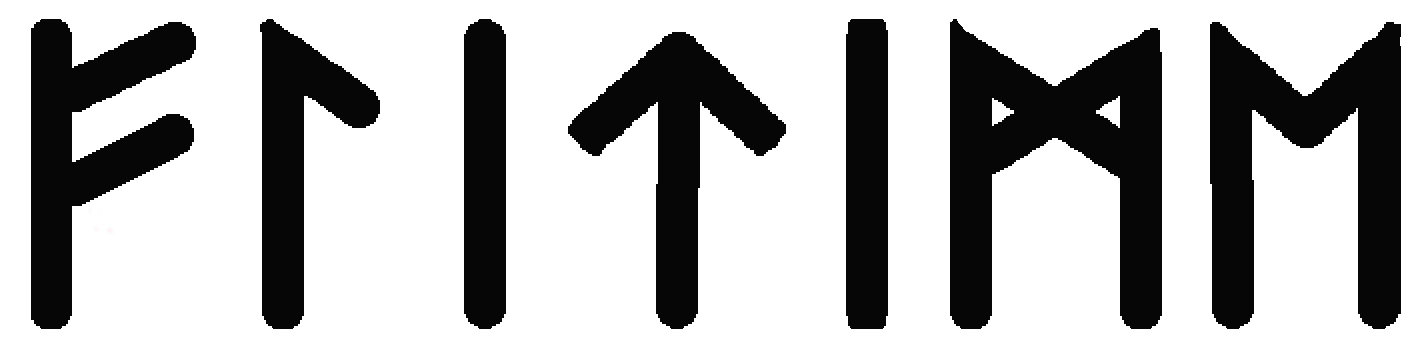Norsk Trikotasjemuseum
Nicht allzu oft haben Museen den Tatsch zum Vergangenen, der Geschichte vom Gestern, also erst einmal Langweilig. Dazu kommt schönstes Wetter, warum also …. Ob Geschichte nun langweilig ist oder nicht, mich jedoch hat die Geschichte in diesem Museum ziemlich beeindruckt und ja, auch ein bisschen betrübt.
Selbst wenn Stricken nicht zu deiner Freizeitbeschäftigung zählt, musst du keine Strick- oder Garnkenntnisse vorweisen, um dieses Museum zu geniessen.
Das farbige Garn, aufgedreht auf einer Kartonspindel zu Beginn des Museums, widerspiegelt eines der Produkte, welches in den kommenden Räumlichkeiten Teil vergangener Produktionen war. Hergestellt mit Maschinen mit filigraner Technik, oft älter als jeder Museumsbesucher und dennoch als «Vorführobjekt» in Schuss gehalten.


Eine Tour durch das Museum ist definitiv die Zeit wert.
Die Fabrik
Die Salhus Strickmanufaktur wurde im Jahre 1859 von Philip Christian Clausen und Johan Ernst Ramm gegründet und galt der Herstellung von Unterwäsche aus Baumwolle und Wolle. Die Nachfrage der Produkte sank, so dass die Produktion eingestellt die Manufaktur 1989 geschlossen und wurde 2001 als Museum wiedereröffnet wurde. Im Laufe der Produktionszeit ist der Maschinenpark modernisiert, ersetzt und erweitert worden. Die Belegschaft wuchs von 30 Personen im Gründungsjahr 1859 auf ungefähr 100 Mitarbeiter um 1900 an und erreichte in den späten 1950er Jahren mit 357 Beschäftigten ihren Höhepunkt. Die meiste Zeit über deckte die Manufaktur den Grossteil der Produktionskette für gestrickte Textilien ab, von der Kardierung und dem Spinnen über das Spulen und Stricken bis hin zum Schneiden und Nähen der Kleidung.
Die Erste Arbeiterwohnung
Beim Blick aus einem der Fenster, lässt sich ein graues Haus mit grünen Fensterrahmen erkennen – eine erste Arbeiterwohnung, errichtet 1860. Laut der Volkszählung von 1875 lebten in diesem Haus 42 Menschen, verteilt auf 8 Familien. Diese Familien teilten sich drei Küchen, welche sich an verschiedenen Eingängen im Erdgeschoss befinden. Innerhalb jeder Küche gibt es kleine Schlafkammern, und in jeder Küche führt eine Treppe in den zweiten Stock mit weiteren kleinen Räumen für jede Familie.
Die Karderei
Eine Etage tiefer befindet sich die Kardenabteilung, die Spinnerei, die Wäscherei und die Färberei in denen die Wolle gereinigt, Fäden sowie Stoffe gefärbt wurden. In der Kardenabteilung und der Spinnerei arbeiteten bis in die 1970er Jahre hinein ausschliesslich Männer. Die Arbeit in der Fabrik war körperlich anstrengend und eintönig. Oftmals dieselben Handgriffe, dies über mehrere Tage
Bis auf ein paar wenige Arbeiten galten alle anderen als beschwerlich. Insbesondere dann, wenn man stundenlang in derselben Position verharrte. Lärm stellte ein Problem in allen Abteilungen dar.
Ein Arbeitstag entsprach bei weitem nicht den heutigen Anforderungen:
1875 dauerte er von 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr im Winter, mit Frühstückspause um 09:00 Uhr und Mittagspause um 13:00 Uhr. Im Sommer begann der Tag um 05:00 Uhr und endete um 20:00 Uhr.
1897 wurde der Zehn-Stunden-Arbeitstag eingeführt. 1919 wurde der Acht-Stunden-Arbeitstag und eine 48-Stunden-Woche eingeführt, da weiterhin auch an Samstagen gearbeitet wurde.“
Dieser Teil der Kardenfabrik wurde im Jahr 1900 erbaut und stellt den ältesten und noch erhaltenen Teil der Produktionsanlagen dar. Die Decke ist in diesem Bereich niedriger, und die Maschinen sind dicht beieinander angeordnet. Ursprünglich war im Erdgeschoss eine Kardenabteilung untergebracht, während sich im ersten und zweiten Stock Spinnerei und Wolllagerung befanden. Der Fluss Milaelva fliesst unter dem Gebäude hindurch und versorgt die Mühle mit Wasser für das Waschen und Färben. (Hinweis: „Karderei“ oder „Kardenabteilung“ bezieht sich auf den Prozess der Karden, bei dem Flusen oder lose Wollfasern in eine matte, parallele Struktur gebracht werden, um die Vorbereitung für das Spinnen zu ermöglichen.)




Die Kordiermaschine Oscar Schimmel, Deutschland 1910
Die Kardiermaschine setzt sich aus drei miteinander verbundenen Komponenten zusammen. Von der Einführung der Wolle an einem Ende der Maschine wird das Garn über Walzen mit Metallzähnen geführt, die Verunreinigungen und Verwicklungen in den Fasern entfernen. Die Wolle wird einmal gekämmt und dann über ein Förderband transportiert und zweimal gewendet und gekämmt, bevor die gekämmte Wolle in Streifen unterteilt wird. Das Endprodukt oder das Vorläufergarn wird auf grosse Metallspulen gewickelt. Die Fasern sind nun parallel zueinander ausgerichtet. Dem Vorgarn fehlt es jedoch an Festigkeit und muss gesponnen werden, um zu Garn zu werden. Der Text beschreibt den Prozess der Kardierung, bei der Wolle oder andere Fasern gekämmt werden, um die Fasern parallel auszurichten und Verunreinigungen zu entfernen. Das Ergebnis ist eine gleichmässige, reine Faser, die als Vorläufergarn bezeichnet wird. Dieses Vorgarn ist jedoch nicht fest genug und muss gesponnen werden, um zu Garn werden zu können. Insgesamt ist der Text professionell und präzise, wobei die einzelnen Schritte der Kardierung detailliert beschrieben werden.



Die Kardiermaschine wird von drei Elektromotoren betrieben. Die Maschine ist minzgrün mit dekorativen Zahnrädern mit geschwungenen Speichen, die typisch für Maschinen aus etwa 1900 sind. Normalerweise arbeiteten ein oder zwei Männer an dieser Art von Maschine, füllten Wolle nach und überprüften sie, um jegliche Verunreinigungen oder kleine Kiesel-steine zu entfernen. Ein Mechaniker sorgte dafür, dass alle Schmierpunkte mit Öl gefüllt waren und dass alle Teile der Maschine reibungslos liefen.
Die Spinnmaschine Rieter Winterthur, Schweiz 1958
Dies ist eine elektrische Ringspinnmaschine. Das Vorvorgarn von der Kardenmaschine wird oben auf der Maschine positioniert. Der Spinnprozess streckt und verdreht das Vorvorgarn zu Garn. Diese Maschine kann gleichzeitig 136 Fäden spinnen. In dieser Abteilung arbeiteten hauptsächlich Männer, und das Spinnen war ein gängiger Einstiegjob für junge Männer. Der Kardiermeister hatte die oberste Position inne und hatte einen vollständigen Überblick über die Fasermischungen für die verschiedenen Produkte. (Bitte beachten Sie, dass „Vorgarn“ und „Vorvorgarn“ möglicherweise nicht die korrekten Fachbegriffe sind. Ich bin kein Experte für die Textilindustrie. Falls notwendig, können Sie diese Begriffe gerne überprüfen und anpassen.)

Die Spulmaschine Leesona, USA 1956
Die Spulmaschine Leesona, hergestellt in den USA im Jahr 1956, ist eine wichtige Maschine in dem Prozess der Garnherstellung. Hier wird der Faden von der Spinnmaschine von zylinderförmigen Spulen auf spitze, kegelförmige Pappspulen umgespult. Diese Spulen sind eigenständig stabil, haben ein grösseres Fassungsvermögen als die Spulen und die schmale Spitze erleichtert das Übertragen des Fadens auf die empfindlichen Nadeln der Strickmaschinen. Während des Umspulens passiert jeder Faden eine kleine, runde Wachsscheibe und wird so mit Wachs behandelt. Diese Behandlung macht den Faden stärker und glatter, was das Verfilzen verhindert und die Kompatibilität mit den feinfühligen Nadeln der Strickmaschinen erhöht. Traditionell wurde das Spulen des Fadens in Salhus und vielen anderen Fabriken zu einer Aufgabe für Frauen. Zu den Aufgaben gehörte unter anderem das Auswechseln leerer gegen volle Spulen und das Überwachen des Umspulens, um ein Verheddern des Fadens zu verhindern. Wenn die Spule voll war, wurde der Prozess mit der nächsten Spule fortgesetzt. Der Umgang mit der Spulmaschine erforderte nur wenig Schulung und bestand hauptsächlich aus der Wiederholung derselben Bewegungen. Die Arbeit an der Spulmaschine wurde im Akkord bezahlt, wie auch in anderen frauendominierten Abteilungen der Fabrik. Das heisst, die Frauen wurden pro produzierte Ware und nicht pro Stunde entlohnt.







Die Haspelmaschine
Diese Maschine ist die am meisten „hausgemachte“ Maschine in der Fabrik und wurde zuvor in der Bandfabrik Trengereid Fabrikker in Bergen verwendet. Heutzutage wird sie im Museum genutzt, um fertig gezwirntes Garn von einer Spule oder Hülse auf einen Strang umzuspinnen. Hierbei kommt ein schräges Rad zum Einsatz, das das Garn gleichmässig auf breite Haspeln verteilt. Die Maschine ist mit einem Messgerät ausgestattet, mit dem die Menge des verwendeten Garns pro Strang abgelesen werden kann.
Im Geschäft des Museums können Sie auch einen Strang des Garns „Museumstvinn“ kaufen. Alle Stränge, die wir im Geschäft verkaufen, wurden auf dieser Maschine aufgespult. Wenn man Garn färben möchte, ist es einfacher, wenn man das Garn auf einem Strang hat. Zudem ist das Garn auch besser für eine längere Lagerung aufgehoben, wenn es nicht zu straff auf eine Spule aufgewickelt ist. Neben der Haspelmaschine können Sie auch eine weitere Maschine beobachten, die eine umgekehrte Funktion erfüllt: Das Übertragen von Garn von einem Strang auf eine Pappspule
Die Zwirnmaschine Carl Hamel, Deutschland 1934
Diese Maschine verzwirnt zwei oder mehr Fäden zu einem einzigen Faden. Heutzutage wird die Maschine im Museum genutzt, um verschiedene Farben mit dem melierten Garn „Museumstvinn“ zu
Die Stempeluhr
Jetzt können Sie sich bald für eine Tasse Kaffee im Cafe ausstempeln! Jeder Arbeiter besass eine individuelle Karte, die seiner Abteilung zugeordnet war. Man stempelte sich morgens ein, zur Mittagspause aus, nach der Pause wieder ein und stempelten am Ende des Arbeitstages aus. Viermal pro Tag, sechs Tage die Woche. Es war eine grosse Aufgabe für das Lohnbüro, das Gehalt für alle 350 Angestellten jede Woche zu berechnen, zusätzlich zu der Akkordarbeit der Frauen in der Spulerei und der Näherei.
Die Arbeiter wurden pro Stunde im Laufe des Arbeitstages bezahlt. Es gab keinen Vorteil, wenn man zu früh einstempelte, hingegen musste man mit Lohnabzügen rechnen, wenn man zu spät kam.
Strickerei und Näherei
In der Etage höher befand sich die Strickerei und die Näherei. In der Strickerei wurden Stoffe als Meterware gestrickt, dies vor allem durch Männer, die dort arbeiteten. Arbeiten in der Strickerei galt nicht nur als angesehen, sondern diejenigen, die hier arbeiteten, erhielten sowohl Maschinenkenntnisse als auch einen Stundenlohn.
In der Näherei wurden die Stoffe von den Strickmaschinen zu Kleidungsstücken vernäht. Besonders die Baumwollunterwäsche der Marke „Krone Maco“ und die Wollpullover vom Typ „Islender“ waren sowohl in Norwegen als auch im Ausland beliebt.



Als die grösste Abteilung innerhalb der Produktionen galt die Näherei mit ihren 200 Näherinnen. Arbeitsverträge, auf Akkordbasis ausgestellt, war häufig den Frauen vorbehalten.